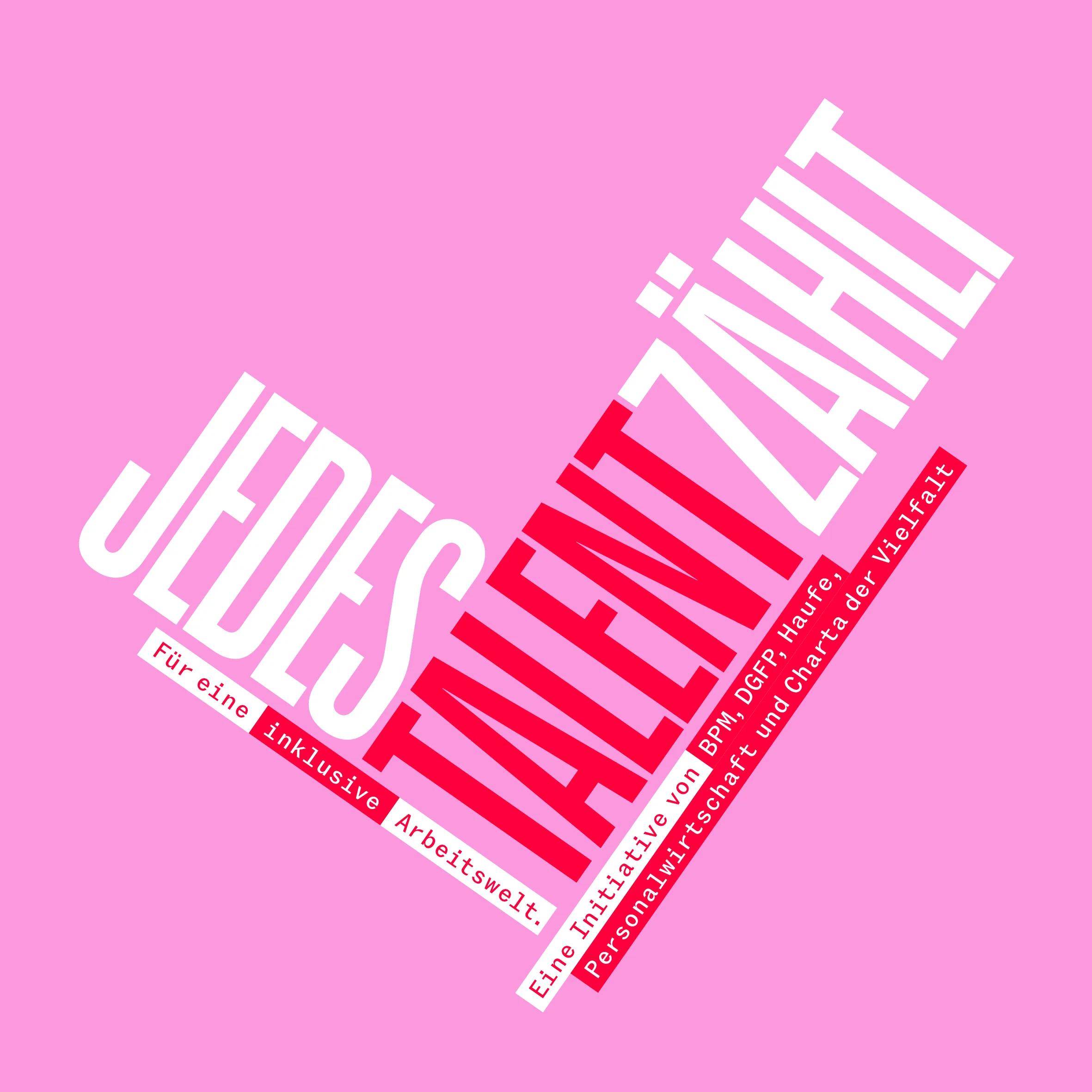"Ich bin Profi im Blindsein"

Inklusion im Management – Eine Frage von (mehr) Fantasie und Vertrauen
Ein blinder Mensch im Vorstand, eine Person im Rollstuhl für die Bereichsleitung, ein Autist als Projektverantwortlicher. Viele Arbeitgeber tun sich mit einer solchen Stellenbesetzung schwer. Es fehlt an Vorstellungskraft – und an gelebter Erfahrung. Was Unternehmen von mehr Offenheit haben und wie Menschen mit Behinderung ihr Führungspotenzial entfalten.
Manchmal passiert selbst ihr das noch. Ihr, der Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands, des VdK, und damit Chefin von mehreren Hundert Mitarbeitenden. Dann versucht wieder jemand ungefragt, Verena Bentele die Kaffeetasse von A nach B zu tragen oder die Moderation einer Diskussionsrunde abzunehmen. Das ist in aller Regel nett gemeint, aber doch übergriffig. „Ich bin Profi im Blindsein und habe Strategien für meinen Alltag entwickelt“, stellt die ehemalige Profisportlerin mit zwölf Paralympics-Goldmedaillen klar. „Ich weiß, wofür ich Hilfe benötige und wofür nicht.“

So wie der 43‑Jährigen geht es vielen Menschen mit Behinderung – im Leben, im Beruf und eben als Führungskraft. Da wird aufseiten der Nichtbehinderten mehr vermutet und unterstellt als erfragt und zugetraut. „Unternehmen ohne entsprechende Erfahrung fällt es schwer, sich einzulassen. Weil jeder, der nicht dem Stereotyp entspricht, erst mal irritiert“, weiß Bentele. „Dabei übersehen wir aber gerne, dass jeder Mensch seine Eigenheiten hat. Es gibt Vorstände, die brauchen jede Rede aufs Komma vorformuliert. Mir reicht es, wenn man mir die wichtigsten Infos gut aufbereitet. Der eine braucht Rauchpausen, der andere Ruhepausen. Jeder ist unterschiedlich. Aber dort, wo die Person nicht dem gewohnten Bild entspricht, werden Eigenheiten eher als Problem empfunden.“ Das bremst Inklusion, besonders im Management.
“Ich bin Profi im Blindsein und habe Strategien für meinen Alltag entwickelt.”
-
Zur Wahrheit gehören zwei
Tatsächlich erfüllen laut der Bundesagentur für Arbeit nur 39 Prozent der Unternehmen ihre Pflichtquote bei der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen voll, der Rest der Wirtschaft setzt auf die Ausgleichsabgabe. In leitenden Positionen sind Menschen mit einer Schwerbehinderung besonders unterrepräsentiert, so eine Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Nicht einmal jeder Vierte hat Führungsverantwortung. Unter den nichtbehinderten Mitarbeitenden ist es fast jeder Dritte (Fulda / Stettes 2024, 17 f.).
Befördern Unternehmen bewusst oder unbewusst weniger Menschen mit Behinderung in leitende Positionen? Sind solche Kandidaten seltener bereit, solche Jobs zu übernehmen? Oder machen viele Chefinnen und Chefs ihre Behinderung schlicht nicht bekannt? Die Antwort ist wohl eine Mischung aus allem und unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen.
Sehr wahrscheinlich liegt die „Dunkelziffer“ tatsächlich höher. Viele leitende Beschäftigte mit Beeinträchtigung machen diese aus Angst vor Stigmatisierung nicht publik. Das ermittelte eine Studie der Universität Melbourne im Jahr 2023 unter australischen und neuseeländischen Führungskräften (Ghin et al 2023, 11-19). Danach versuchten zwei Drittel der Manager mit chronischer Erkrankung, ihre Einschränkung zu kaschieren. Rund 75 Prozent spielten ihre Bedeutung herunter oder verbargen die Symptome. Fast die Hälfte befürchtete, dass die Kollegen sie nicht mehr für fähig genug für ihren Job halten. 39 Prozent rechneten damit, nicht mehr befördert zu werden.

Diese Sorgen sind nicht unberechtigt, auch hierzulande. Viele der Gesprächspartner in diesem Beitrag berichten von solchen Erfahrungen im Laufe ihrer Karriere. Von rollenden Augen über gedankenlose Sprüche bis zu offenen Anfeindungen und übler Nachrede – es erfordert Mut und Energie, mit so etwas umzugehen. Je höher die Position, desto schwieriger wird das offene Gespräch über mögliche Einschränkungen. So stecken viele karriereorientierte Menschen mit Behinderung aus Sorge, den Anforderungen nicht gerecht zu werden und dem Druck nicht standzuhalten, frühzeitig beruflich zurück (Hammermann / Stettes 2024, 7-11).
Wenn Fairness und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen
Egal ob behinderte Menschen, die als Führungskraft geeignet wären, ihre Karriereambitionen nicht äußern oder ob sie beim Rekrutieren oder Befördern gar nicht erst in Erwägung gezogen werden: Unterm Strich bleibt Potenzial ungenutzt, obwohl Führungsstellen vielerorts schwer zu besetzen sind. Inklusion auf Leitungsebene wirkt nach innen und außen, stellt die Präsidentin des Bundes-VDK und Vorständin des Landesverbands Bayern fest. Führungskräfte seien Multiplikatoren und Botschafter der Unternehmenskultur. „Wer Inklusion auf allen Ebenen authentisch lebt, zeigt, dass er es als Unternehmen wirklich ernst meint, und dass Durchlässigkeit tatsächlich funktioniert“, so Verena Bentele. „Ein positives und vertrauensbildendes Signal an die gesamte Belegschaft – mit und ohne Behinderung.“
Dass Teams bessere Lösungen hervorbrächten, wenn sie möglichst divers besetzt sind, sei allgemein anerkannt, ergänzt die Managerin. Eine facettenreichere Sicht auf die Welt, auf Mitarbeitende, Kaufende, Prozesse und Produkte sei immer von Vorteil. „Und je mehr von dieser Vielfalt ich inhouse pflege, desto weniger Expertise muss ich von außen einholen“, so ihre nüchterne Rechnung.
In Stärken statt Defiziten denken
Was also kann helfen, dass sich mehr Arbeitgeber die Inklusion von Führungskräften zutrauen und mehr Menschen mit Behinderung in leitende Positionen streben? Erfahrene Führungskräfte mit Behinderung halten zwei Aspekte für essenziell: Vertrauen und Mut. Sie wissen selbst am besten, was sie können und wo sie Unterstützung benötigen – ihnen wird jedoch selten zugehört. Stattdessen prägen Fremdbilder: Menschen ohne Behinderung entwickeln Annahmen darüber, was möglich ist und was nicht. Allzu schnell wird in Problemen gedacht, die in der Praxis keine sind oder deutlich kleiner ausfallen.

„Ich bin ein kerngesunder Mensch“, sagt Jörg Korinek. „Ich kann nur nicht sehen. Darum löse ich Aufgaben nicht immer auf dem Standardweg, sondern mit Alternativen.“ Der Informatiker leitet beim Softwareunternehmen Datev seit mehreren Jahren ein fünfköpfiges Team für digitale Barrierefreiheit und weiß um seine idealen Bedingungen: „Unterstützende Vorgesetzte und ein eingespieltes Team, das meine Möglichkeiten und Grenzen mitdenkt.“
Moderne Hilfsmittel wie Screenreader und Braillezeile sind die Grundlage für den Alltag. „Und wenn es irgendwo hakt, bitte ich um Hilfe – oder entwerfe einen Workaround, der dann am Ende gleich für alle praktischer sein kann.“ Dass ihm in Gesprächen Gestik und Mimik des Gegenübers fehlen, kompensiert der 58‑Jährige großenteils über dessen Stimme, Auftreten und Ausstrahlung. „Ich weiß, das ist für andere schwer nachzuvollziehen. Gerade deshalb sollten Unternehmen mehr Vertrauen in das Urteilsvermögen ihrer Mitarbeitenden haben und mehr Mut aufbringen, Dinge einfach mal auszuprobieren.“
Erfahrungen ermöglichen
Mehr miteinander als übereinander reden, darauf setzt die Adecco Group, darauf setzt Nadine Schönwald. Seit 21 Jahren bei dem Personaldienstleister, leitet die 44‑Jährige ein fünfköpfiges Team zur Vertriebsunterstützung – und engagiert sich als Inklusionsbeauftragte. Sie blickt pragmatisch auf ihre Gehbehinderung: „Ich habe gewisse körperliche Einschränkungen, aber ich muss ja auch nicht als Maurerin arbeiten.“ Ihr ist es wichtig, Präsenz zu zeigen, Fragen offen aufzunehmen, Bewusstsein zu schaffen – dafür, dass Menschen mit Behinderung mehr sind als nur ihre Behinderung. „Ein Beispiel: Ich bin freundlich, nett und mit 1,45 Meter sehr klein. Da wird von manchen gerne vergessen, dass ich bei Verhandlungen um Millionenverträge entscheidend beigetragen habe,“ beobachtet Schönwald.
Adecco hat 2024 Inklusion global als Unternehmenswert festgeschrieben. Als Inklusionsbeauftragte hat Schönwald am Aktionsplan mitgearbeitet, ein bundesweites Inklusionsnetzwerk aufgebaut und externe Perspektiven hereingeholt: Zwei schwerbehinderte Beraterinnen des Hildegardis-Vereins nahmen das Haus unter die Lupe und sprachen Empfehlungen aus.
Regelmäßige Sichtbarkeit nach innen und außen ist Teil der Strategie: Mindestens einmal im Monat geht es im Firmennewsletter um inklusive Themen; auf Konferenzen teilt Schönwald bundesweit als Speakerin ihre Erfahrungen, im aktuellen Role-Model-Projekt der Universität Köln und der Fortbildungsakademie der Wirtschaft hat sie als Expertin mitgewirkt. Auf LinkedIn erreicht sie mit ihren Beiträgen fast 20 000 Follower – und ist für Kollegen wie für die Kundschaft feste Ansprechpartnerin zum Thema. Der Effekt: weniger Berührungsängste, mehr Alltag. „Wenn Inklusion stärker sichtbar und erlebbar wird, haben alle was davon“, sagt Schönwald.
Die Macht der Vorbilder
Auch Dr. Kristin Futterlieb hat sich für Sichtbarkeit entschieden, obwohl sie ihren angeborenen Organschaden und die Einschränkungen dadurch verbergen könnte. „Als Führungskraft halte ich es für meine Verantwortung, offen über meine Schwerbehinderung zu sprechen, damit Normalität entsteht und sich meine Mitarbeitenden auch trauen. Ich beobachte, dass ihnen das tatsächlich eine Last nimmt.“ Seit 15 Jahren führt die 52‑Jährige und leitet aktuell als Fachbereichsleiterin beim Bezirksamt Berlin-Lichtenberg vier Stadtbibliotheken mit 69 Mitarbeitenden.
Futterlieb ist es wichtig, neue Sichtweisen zuzulassen. „Wenn ich ohnehin kaum Personal finde, warum nicht auch eine Bibliothekarin einstellen, obwohl sie hochschwanger ist“, fragt sie und freut sich auf die neue Kollegin, die im Dezember anfängt. Sie würde auch kompetente Kandidaten im Rollstuhl probearbeiten und ihnen die Entscheidung lassen, ob sie sich das Regaleinräumen zutrauen. Aktuell in Vorbereitung ist ein Fachtag für alle, die in Berliner Bibliotheken Personalverantwortung tragen: Wie stellt man sich auf die steigende Zahl von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen wie ADHS oder Autismus ein, und wie lassen sich Arbeitsplätze für sie gestalten? „Die Welt verändert sich. Da müssen wir mitgehen.“
Inklusive Recruiting- und Beförderungsprozesse
Dazu gehört, die Recruiting- und Beförderungsprozesse im Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. Führen bewusste oder unbewusste Fehlwahrnehmungen dazu, dass geeignete Kandidaten mit Behinderung durchs Raster fallen? Inklusion sollte grundsätzlich weiter reichen, als behinderte Personen einfach nur einzustellen. Das Unternehmen muss eine Idee entwickeln, welche Perspektiven es diesen Mitarbeitenden bieten kann, und Strukturen etablieren, die Weiterentwicklung ermöglichen.
Das IW empfiehlt, alte Dogmen infrage zu stellen, um mehr Menschen mit Behinderung für Führungspositionen zu gewinnen: Ist Management tatsächlich nur in Vollzeit möglich? Können Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden? Wie viel Homeoffice ist für Vorgesetzte praktikabel? Ein durchlässigeres Angebot auf Führungsebene käme speziell behinderten Mitarbeitenden zugute.
Den Leistungsbegriff überdenken
Führungskräften mit Behinderung wird oft unterstellt, weniger leistungsfähig zu sein. Studien belegen dies nicht. Eine IW-Analyse stellte fest, dass sich karriereorientierte Menschen mit und ohne Behinderung in Sachen Arbeitseinsatz, Pflichtgefühl und Stressempfinden nicht wesentlich unterscheiden. „Natürlich brauchen Unternehmen bei knappem Personalschlüssel möglichst tatkräftige Mitarbeitende,“ merkt Kristin Futterlieb an. „Aber man muss auch sehen, dass nicht jede 100 Prozent gesunde Person auch 100 Prozent leistet.“ Der aktuelle Gallup Engagement Index zeigt, dass sich die große Masse kaum an ihren Arbeitgeber gebunden fühlt. 16 Prozent der Beschäftigten haben sogar innerlich gekündigt.
„Das kann also kein Argument sein,“ stellt Nadine Schönwald fest. Sie beobachtet, dass Führungskräfte mit einer Behinderung oftmals sogar deutlich resilienter und flexibler seien als nichtbehinderte. „Wer zig Operationen hinter sich hat und regelmäßig Barrieren nehmen muss, der ist so was von stressresistent.“
Feedbackkultur ist entscheidend
Regelmäßige Feedbackgespräche zwischen Führung und Mitarbeitenden gehören in den meisten Unternehmen ohnehin zum Standard. Sie lassen sich gezielt nutzen, um Sicherheit und Rückhalt zu signalisieren. „Ich finde es sehr positiv, dass meine Vorgesetzte regelmäßig nachfragt, ob es mir gut geht und ob ich Unterstützung benötige“, sagt Manuela Zachariae. Sie leitet bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ein achtköpfiges Team in den zentralen Diensten und lebt beschwerdefrei mit einer chronischen Krebserkrankung. „Eine Erkrankung ist psychische Belastung genug; umso wichtiger, sich nicht auch noch um Akzeptanz im Job sorgen zu müssen.“ Diese Wertschätzung gibt sie an ihr Team weiter – damit sich alle sicher und gesehen fühlen.